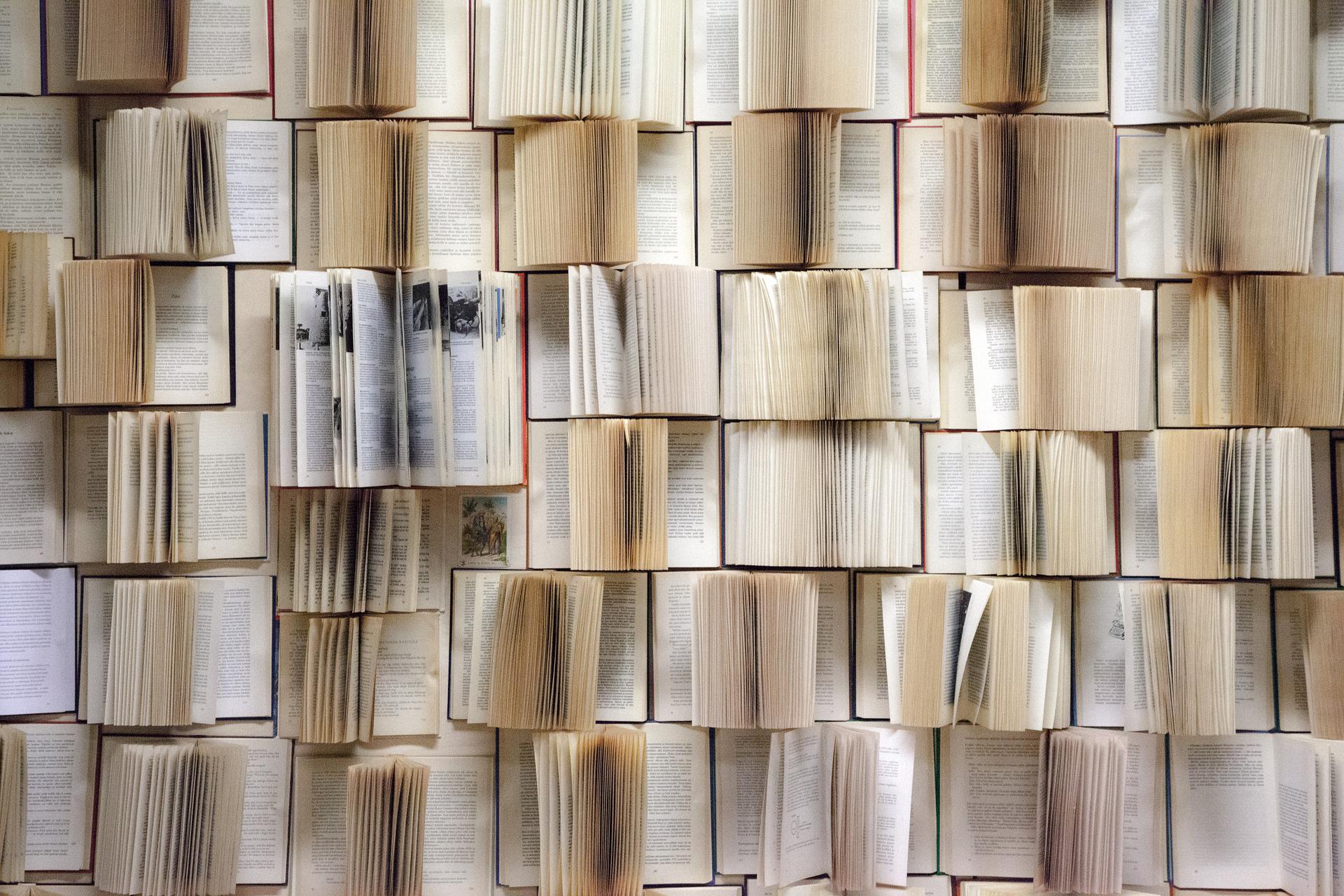Am 8. März 2026 ist es wieder soweit: Bayern wählt. Im Rahmen einer Online-Session informiert die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit über die Kommunalwahl 2026 und steht für Fragen zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt zentral über den bvv: https://vhs.link/qznVtC
Pick-Up-Artists, alpha males und Tradwifes – die derzeitigen Trends auf sozialen Medien vermitteln idealisierte Vorstellungen von echter Maskulinität und fürsorglicher Weiblickeit, hinter denen mehr als nur Selbstoptimierung steckt. Viele der Influencer auf TikTok, YouTube und Instagram vermitteln mit den scheinbar unpolitischen Einblicken in ihren Alltag traditionelle Geschlechtervorstellungen sowie patriarchale und frauenfeindliche Weltbilder, die durch ihre enorme Reichweite eine Rolle rückwärts in den Geschlechterbeziehungen in viele Teenagerzimmer tragen. Im Webtalk wollen wir diskutieren, wie strategisch und organisiert die Szene im Netz auftritt und wo es Verbindungen zu antidemokratischem Gedankengut gibt.
Ob Sprachassistent, Bildgenerator oder medizinische Analyse – Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen. Gleichzeitig tobt ein globaler Wettlauf um technologische Führungspositionen. Staaten und Unternehmen investieren Milliardenbeträge, um bei der Entwicklung von KI ganz vorne mitzuspielen. Doch der technologische Fortschritt hat seinen Preis: Das Training großer KI-Modelle verschlingt enorme Mengen an Energie und Wasser. Gemeinsam wollen wir mit Ihnen und unseren Expertinnen und Experten darüber diskutieren, welche ökologischen Folgen der KI-Boom mit sich bringt und welche politischen Leitplanken es braucht, damit ökologische Fragen im globalen KI-Wettlauf nicht auf der Strecke bleiben.
Was prägt unser heutiges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem – und warum steht es immer wieder in der Kritik? Seit seinen Anfängen begleitet den Kapitalismus eine Vielzahl von Deutungen und Gegenbewegungen: von moralischer Empörung über soziale Ungleichheit bis zu grundlegenden Fragen nach Macht, Eigentum und Gerechtigkeit. Kapitalismuskritik ist so alt wie das System selbst – und zugleich hochaktuell in Zeiten von Klimakrise, Digitalisierung und globaler Ungleichheit. Im Kurs gehen wir der Entwicklung dieser Kritik nach: Wie wurde der Kapitalismus seit der Industrialisierung beurteilt – von Marx über Keynes und der Frankfurter Schule bis zu heutigen Stimmen aus Ökologie, Feminismus und Postwachstumsbewegung? Welche Krisen und gesellschaftlichen Umbrüche haben sie geprägt, und welche Alternativen oder Reformideen wurden daraus entwickelt? Zugleich fragen wir: Warum polarisiert Kapitalismuskritik bis heute? Wie verändern sich Argumente, wenn ökologische Grenzen, soziale Spaltung und politische Instabilität stärker ins Bewusstsein rücken? Und was bedeutet all das für unser eigenes Verständnis von Arbeit, Konsum und Wohlstand? In Gesprächen, kurzen Inputs und Textbeispielen reflektieren wir die Vielschichtigkeit kapitalismuskritischer Perspektiven – von theoretischer Analyse bis persönlicher Haltung. Ziel des Kurses ist es, historische Linien und aktuelle Argumente der Kapitalismuskritik kennenzulernen, deren Motive zu verstehen und eigene Positionen differenzierter zu entwickeln. Kursleitung: Kai Kaufmann Ausführende vhs: vhs Puchheim-Eichenau
Digitale Spiele begeistern Menschen aller Altersgruppen – doch wie gelingt ein wirksamer Jugendschutz zwischen Faszination und Verantwortung? Online Gaming verändert sich schnell, ständig kommen neue Spiele, Features und Spielmöglichkeiten hinzu. Darauf muss auch der Jugendschutz reagieren. Die Entscheidung der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), die Altersfreigabe der Spieleplattform „Roblox“ von 12 auf 16 Jahre anzuheben, zeigt, dass der Jugendschutz aktuelle Entwicklungen im Gaming-Segment im Blick hat. Dennoch sehen Eltern, pädagogische Fachkräfte und Jugendschützer weiteren Handlungsbedarf. Gemeinsam diskutieren wir, wo es derzeit Lücken im System gibt und wie gesetzliche Vorgaben und technische Lösungen mit elterlicher Begleitung sinnvoll ineinandergreifen können.
Üblicherweise gehen wir davon aus, dass Entscheidungen auf dem Abwägen von Gründen beruhen sollten, während man sich durch Losverfahren dem blinden Zufall ausliefert. Das scheint auf den ersten Blick irrational zu sein. Tatsächlich gab es aber Losentscheidungen in vielen Lebensbereichen und nicht zuletzt in der Politik schon immer. Der Vortrag geht der Frage nach, wie Losverfahren in der Vergangenheit begründet wurden, und zeigt anhand historischer Beispiele, wie sie funktionierten. Barbara Stollberg-Rilinger ist Historikerin und Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Sie ist vielfach ausgezeichnet u.a. mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Wir leben in Zeiten der Entfernung. Die politischen Lager, die großen Machtblöcke der Welt, die Stadt vom Land – alles entfernt sich voneinander. Umso wichtiger wird der Blick aus der Nähe. Wo ist im Zeichen medial befeuerter Selbstgerechtigkeit noch Gemeinschaft möglich? Der Schriftsteller und Journalist Simon Strauß findet eine überraschende Antwort: in der Kleinstadt. Hier begegnen sich die Menschen als Gegenüber, hier müssen Konflikte ausgetragen und Kompromisse gefunden werden. Hier lernt man die Demokratie noch einmal neu kennen. Simon Strauß studierte Altertumswissenschaften und Geschichte in Basel, Poitiers und Cambridge. Er ist Mitgründer der Gruppe „Arbeit an Europa". 2017 promovierte er an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Schriftsteller und Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Sprache ist nie unschuldig. Sie kann verbinden oder spalten, Wirklichkeit abbilden oder formen. In Debatten über Gender, Migration oder Politik wird deutlich, wie sehr Worte selbst umkämpft sind – und wie stark sie Wahrnehmung, Denken und gesellschaftliche Dynamiken prägen. Doch wie genau wirkt Sprache? Und welche Verantwortung haben wir im Umgang mit ihr? Der Kurs untersucht, wie Sprache als Werkzeug der Macht funktioniert – von politischen „Frames“ und medialen Deutungsrahmen über Alltagsmetaphern bis hin zu Sprachwandel und neuen Ausdrucksformen. Anhand aktueller Beispiele wird sichtbar, wie durch Begriffe Realitäten geschaffen oder verdeckt werden: „Flüchtlingswelle“, „Leistungsträger“, „Klimahysterie“ – jedes Wort trägt eine Haltung in sich. Wir diskutieren philosophische und linguistische Perspektiven auf Sprache und fragen zugleich praktisch: Wie lässt sich bewusster, präziser und dialogfähiger sprechen? Wo stößt „politische Korrektheit“ an Grenzen – und wo ist sie Ausdruck von Respekt und Verantwortung? In Übungen und Diskussionen erproben wir den sensiblen Umgang mit Sprache als Mittel gesellschaftlicher Gestaltung. Ziel des Kurses ist es, Sprache als Machtinstrument zu durchschauen – und sie zugleich als Werkzeug des Verstehens und der Verständigung neu zu entdecken. Kursleitung: Kai Kaufmann Ausführende vhs: vhs Puchheim-Eichenau
Digitale Teilhabe für alle – ein Anspruch, der in Deutschland rechtlich verankert ist, aber praktisch nicht erreicht wird. Bereits seit 2019 sind öffentliche Stellen zur barrierefreien Gestaltung ihrer Websites und mobilen Anwendungen verpflichtet. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), das Ende Juni 2025 in Kraft tritt, nimmt nun die Wirtschaft in die Pflicht. Es zielt darauf ab, die gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen am Wirtschaftsleben zu fördern. Das Gesetz enthält Anforderungen an die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Websites und Apps, und legt spezifische Vorgaben für die barrierefreie Gestaltung fest. In diesem Webtalk sprechen wir darüber, warum Barrierefreiheit so wichtig ist für gesellschaftliche Teilhabe und analysieren Herausforderungen bei der Umsetzung in Wirtschaft, Verwaltung und Bildung.
Experten beobachten, dass sich besonders junge Menschen in sozialen Medien radikalisieren. In der öffentlichen Debatte werden vor allem technische Faktoren wie Algorithmen als Ursache ausgemacht; soziale Dynamiken und Gruppeneffekte werden hingegen weniger beachtet. Dabei tragen gerade Gemeinschaft und der Austausch mit Gleichgesinnten maßgeblich zur Meinungsbildung und zur Festigung von Weltbildern bei. Andererseits haben soziale Netzwerke auch positive Seiten, weil Menschen sich ortsunabhängig vernetzen, Unterstützung erfahren und Gemeinschaft erleben können. Im Webtalk möchten wir gemeinsam diskutieren, wie soziale Medien als digitale Vernetzungsräume funktionieren.